
Martin Eckstein wird am 15. August 1929 in Weinheim geboren.
Die Nazis verschleppen ihn mit seiner Schwester Lore und den Eltern Felice und Albert in das Lager Gurs. Mitarbeiterinnen der Quäker bringen Martin und weitere 47 Kinder im Februar 1941 aus dem Lager Gurs in das Waisenhaus in Aspet. Anfang Februar 1943 begleitet Alice Resch, eine Mitarbeiterin der Quäker, ihn an die Grenze zur Schweiz. Der Grenzübertritt gelingt am 4. Februar 1943.
Die Nazis deportieren die Schwester im Juni 1942 „in den Osten“, sie ist seitdem verschollen. Die Eltern sind in dem Todeszug, der am 10. August 1942 von Drancy Richtung Auschwitz fährt. Martin Eckstein sorgt mit anderen Geretteten dafür, dass Alice Resch von Yad Vashem 1982 als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt wird.
Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle
Quelle: B.&G. Brändle: Gerettete und ihre Retter*innen. Jüdische Kinder im Lager Gurs, hrsg. von IRG Baden, Karlsruhe 2021.
Externer Link: Veröffentlichung als Download (pdf)

Lore Eckstein wird am 18. August 1922 in Eberbach geboren.
Die Nazis verschleppen sie mit ihrem Bruder Martin und den Eltern Felice und Albert in das Lager Gurs. Die Nazis deportieren sie nach dem Bericht ihres Bruders Martin im Juni 1942 „in den Osten“, sie ist seitdem verschollen.
Die Eltern sind in dem Todeszug, der am 10. August 1942 von Drancy Richtung Auschwitz fährt. Der Bruder Martin wird von Alice Resch, Mitarbeiterin der Quäker, im Februar 1941 in das Heim in Aspet und im Februar 1943 an die Grenze zur Schweiz gebracht. Er wird gerettet.
Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle
Quelle: B.&G. Brändle: Gerettete und ihre Retter*innen. Jüdische Kinder im Lager Gurs, hrsg. von IRG Baden, Karlsruhe 2021.
Externer Link: Veröffentlichung als Download (pdf)

Ethel Zloczower wird am 16. November 1924 in Pforzheim geboren.
Sie muss, wie ihre Geschwister Adelheid und Sally, ab 1936 das „Schulghetto“ an der Hindenburgschule (heute: Osterfeldschule) besuchen.
Die Nazis verschleppen sie mit ihren Geschwistern Adelheid und Sally und den Eltern Sofie und Marcel in das Lager Gurs. Sie und die Eltern kommen 1941 in das Lager Rivesaltes, Adelheid und ihr Bruder Sally werden durch Mitarbeiterinnen des OSE in das OSE-Heim im „Château Chabannes“ und im September 1942 in die Schweiz gerettet.
Ethel und ihren Eltern gelingt es, in das Lager in La Meyze südlich von Limoges verlegt zu werden. In diesem Lager für ältere und arbeitsunfähige Ausländer kümmern sich Mitarbeiterinnen des CIMADE um die Internierten.
Sie und ihre Eltern überleben dort und nach der Befreiung kommen Adelheid und Sally ebenfalls nach La Meyze.
Die Familie wandert nach 1945 in die USA aus.
Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle
Quelle: B.&G. Brändle: Gerettete und ihre Retter*innen. Jüdische Kinder im Lager Gurs, hrsg. von IRG Baden, Karlsruhe 2021.
Externer Link: Veröffentlichung als Download (pdf)

Adelheid Zloczower wird am 16. Juni 1929 in Pforzheim geboren.
Sie muss, wie ihre Geschwister Ethel und Sally, ab 1936 das „Schulghetto“ an der Hindenburgschule (heute: Osterfeldschule) besuchen.
Die Nazis verschleppen sie mit ihren Geschwistern Ethel und Sally und den Eltern Sofie und Marcel in das Lager Gurs. Die Eltern und die Schwester Ethel kommen 1941 in das Lager Rivesaltes, Adelheid und ihr Bruder Sally werden durch Mitarbeiterinnen des OSE in das OSE-Heim im „Château Chabannes“ gerettet. Nach der Razzia der Vichy-Polizei am 26. August 1942 organisiert der Betreuer Ernst Jablonski/Ernest Jouhy, der der verbotenen kommunistischen Partei angehört, Verstecke für die von Verschleppung bedrohten Kinder, darunter auch Adelheid und Sally Zloczower. Die Geschwister werden dann in das Kinderheim „La Pouponnière“ in Limoges und weiter von Helferinnen an die Schweizer Grenze gebracht. Der Grenzübertritt mithilfe unbekannter Passeure am 17. September 1942 erfolgt ungehindert.
Die Eltern und die Schwester Ethel werden in das Lager La Meyze südlich von Limoges verlegt, das für ältere bzw. arbeitsunfähige Ausländer eingerichtet wird. Sie überleben. Nach der Befreiung kommen Adelheid und Sally ebenfalls nach La Meyze.
Die Familie wandert nach 1945 in die USA aus.
Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle
Quelle: B.&G. Brändle: Gerettete und ihre Retter*innen. Jüdische Kinder im Lager Gurs, hrsg. von IRG Baden, Karlsruhe 2021.
Externer Link: Veröffentlichung als Download (pdf)

Sally Zloczower wird am 13. Dezember 1926 in Pforzheim geboren.
Er muss, wie seine Schwestern Adelheid und Ethel, ab 1936 das „Schulghetto“ an der Hindenburgschule (heute: Osterfeldschule) besuchen.
Die Nazis verschleppen ihn mit seinen Schwestern Adelheid und Ethel und den Eltern Sofie und Marcel in das Lager Gurs. Die Eltern und die Schwester Ethel kommen 1941 in das Lager Rivesaltes, Adelheid und Sally werden durch Mitarbeiterinnen des OSE in das OSE-Heim im „Château Chabannes“ gerettet. Nach der Razzia der Vichy-Polizei am 26. August 1942 organisiert der Betreuer Ernst Jablonski/ErnestJouhy, der der verbotenen kommunistischen Partei angehört, Verstecke für die von Verschleppung bedrohten Kinder, darunter auch Adelheid und Sally Zloczower. Die Geschwister werden dann in das Kinderheim „La Pouponnière“ in Limoges und weiter von Helferinnen an die Schweizer Grenze gebracht. Der Grenzübertritt mithilfe unbekannter Passeure am 17. September 1942 erfolgt ungehindert.
Die Eltern und die Schwester Ethel werden in das Lager La Meyze südlich von Limoges verlegt, das für ältere bzw. arbeitsunfähige Ausländer eingerichtet wird. Sie überleben. Nach der Befreiung kommen Adelheid und Sally ebenfalls nach La Meyze.
Die Familie wandert nach 1945 in die USA aus.
Autoren: Brigitte und Gerhard Brändle
Quelle: B.&G. Brändle: Gerettete und ihre Retter*innen. Jüdische Kinder im Lager Gurs, hrsg. von IRG Baden, Karlsruhe 2021.
Externer Link: Veröffentlichung als Download (pdf)
Hermine Simon (geb. Barth) wird am 9. Januar 1890 in Flehingen (Baden) geboren.
Sie und ihr Ehemann Emil haben eine gemeinsame Tochter, Felice. Sie wird am 3. März 1912 geboren. Das Ehepaar wohnt bis 1940 in der Östlichen Karl-Friedrichstraße 15.
Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie die jüdische Gaststätte „Café Simon“ in Pforzheim, das sich in der Leopoldstraße 18 befindet. Am Morgen des 10. November 1938 wird auch ihr Lokal zerstört. Auf Befehl der SA wird sie verwüstet und geplündert. Ihnen wird der Zutritt zu ihrem Lokal verboten.
Am 22. Oktober 1940 wird das Ehepaar in das Lager Gurs verschleppt. In Gurs verstirbt Emil Simon am 10. Juni 1941. Auch Hermine kommt im Lager ums Leben.
Ihre Tochter Felice überlebt die Verfolgung und lebt später in den USA.
Autorin: Wusha Mohammed (Projektgruppe „Geschichte aktiv“)
Selma David (geb. Metzger) wird am 15. Juni 1877 in Pforzheim geboren.
Sie wohnt zusammen mit ihrem Mann Serge und den Töchtern Lilli und Lore in der Hohenzollernstraße 34 in Pforzheim. Sie ist gelernte Kauffrau und Partnerin im Geschäft ihres Schwiegersohns Julius Forster (ehem. Furchheimer) in der Leopoldstraße 18. Durch den Zwangsverkauf entsteht ein Schaden von insgesamt 50.000 Mark.
In der Progromnacht vom 9. auf den 10. November wird ihr Mann Serge von Anhängern des NS-Regimes in der Wohnung bewusstlos geschlagen. Er bekommt erste Hilfe und wird am nächsten Morgen in das städtische Krankenhaus eingeliefert. Er hat eine schwere Kopfverletzung, die genäht werden muss. Sein künstliches Gebiss muss entfernt werden und wird so notdürftig repariert, dass er nicht mehr richtig essen kann. Er erleidet außerdem zahlreiche offene Wunden und sein Ringfinger an der linken Hand ist als Folge einer Verletzung verkürzt. Er liegt drei Wochen im Krankenhaus. Über die Geschehnisse in dieser Nacht berichtet später ihre Tochter Lilli in einem Interview.
1939 kann Selma mit ihrem Mann zunächst in die Schweiz fliehen. Von dort aus wandern sie im Februar 1939 in die USA aus.
Sie leben dort zuletzt in New York City.
Der folgende Kurzfilm enthält Lillis Interview, in dem sie über die Geschehnisse der Pogromnacht spricht.
Autoren: Projektgruppe „Geschichte aktiv“
Serge David wird am 1. September 1874 in Elmshorn in Schleswig-Holstein geboren. Er hat sechs Geschwister.
Nach der Heirat wohnt er mit seiner Frau Selma (geb. Metzger) und den Töchtern Lilli und Lore in der Hohenzollernstraße 34. Er ist Kaufmann.
In der Progromnacht vom 9. auf den 10. November wird er von Anhängern des NS-Regimes in seiner Wohnung bewusstlos geschlagen. Er bekommt erste Hilfe durch Dr. Wilhelm Bopp und wird am nächsten Morgen in das städtische Krankenhaus eingeliefert. Er hat eine schwere Kopfverletzung, die genäht werden muss. Sein künstliches Gebiss muss entfernt werden und wird so notdürftig repariert, dass er nicht mehr richtig essen kann. Er erleidet außerdem zahlreiche offene Wunden und sein Ringfinger an der linken Hand ist als Folge einer Verletzung verkürzt. Er liegt drei Wochen im Krankenhaus. Über die Geschehnisse in dieser Nacht berichtet später seine Tochter Lilli in einem Interview.
1939 kann er mit seiner Frau zunächst in die Schweiz fliehen. Von dort aus wandern sie im Februar 1939 in die USA aus.
Dort lebt er mit seiner Frau in New York City.
,,Ich wurde gefragt: Sind sie Jude? Und auf meine bejahende Antwort wurde ich mit Knüppeln und Stuhlbeinen derartig geschlagen, bis ich bewusstlos liegen blieb. Wenn ich nicht im Unterbewusstsein meine Hände über den Kopf gehalten hätte, wäre ich heute nicht mehr am Leben.“ (Serge David rückblickend in einem Brief)
Der folgende Kurzfilm enthält Lillis Interview, in dem sie über die Geschehnisse der Pogromnacht spricht.
Autoren: Projektgruppe „Geschichte aktiv“
Julius Furchheimer wird am 28. Mai 1892 in Bad Mergentheim geboren.
Gemeinsam mit seiner Frau Lilli (geb. David) und Tochter Edith und den Schwiegereltern Serge und Selma David wohnt er in der Hohenzollernstraße 34.
Julius ist Kaufmann und führt zusammen mit Selma David ein Geschäft in der Leopoldstraße 18. Sie müssen das Geschäft zwangsverkaufen. Dadurch entsteht ein Schaden von insgesamt 50.000 Mark.
Julius erlebt mit, wie in der Pogromnacht am 9. November 1938 Nazischläger in die Wohnung eindringen und seinen Schwiegervater brutal zusammenschlagen. Über die Geschehnisse in dieser Nacht berichtet später seine Frau Lilli in einem Interview (siehe unten).
Ihnen gelingt 1939 die Flucht in die USA. Sie kommen dort am 30. Dezember 1939 in New York an.
Die Familie versucht einen Neuanfang in einem fremden Land. Julius eröffnet ein neues Geschäft ,,Julius Forster Pearls and Jewelery Import-Export“. 1943 ändert er seinen Namen offiziell von Furchheimer in Forster.
Die Familie Forster lebt zuletzt in New York City.
Der folgende Kurzfilm enthält Lillis Interview, in dem sie über die Geschehnisse der Pogromnacht spricht.
Autoren: Projektgruppe „Geschichte aktiv“

Irene Geller wird am 23. Februar 1922 in Söllingen (Karlsruhe) als Kind von Leopold und Friederike Geller geboren.
Ihr Vater besitzt ein Zigarren- und Zigarettengeschäft in der Zerrennerstraße, welches er 1935 in Folge der Boykottmaßnahmen aufgeben muss. Ihre Mutter Friederike stirbt bereits 1935 in Pforzheim, die Todesursache ist nicht bekannt.
Irene besucht vier Jahre die Volksschule und danach die Hildaschule. Diese muss sie 1937 aufgrund ihres Glaubens verlassen. Irene flüchtet im März 1938 zunächst per Zug nach Marseille und gelangt mit dem Schiff „Champolion“ nach Palästina.
Irenes jüngerer Bruder Herbert kann 1939 in die USA fliehen. Ihr Vater Leopold wird 1940 in das Lager Gurs verschleppt, 1942 weiter nach Auschwitz deportiert und ermordet.
In Palästina baut sich Irene ein neues Leben auf. Sie heiratet Joschua Remes und gründet eine Familie. Sie bekommen drei Kinder.
Irene Gellers letzter bekannter Wohnort befindet sich in Magdiel, Israel.
„Mein Vater wurde im Jahr 1940 (…) in das Lager Gurs deportiert. Es ist anzunehmen, dass [er] in der Deportation ums Leben gekommen ist (…)“ (Irene Geller in einem Brief)
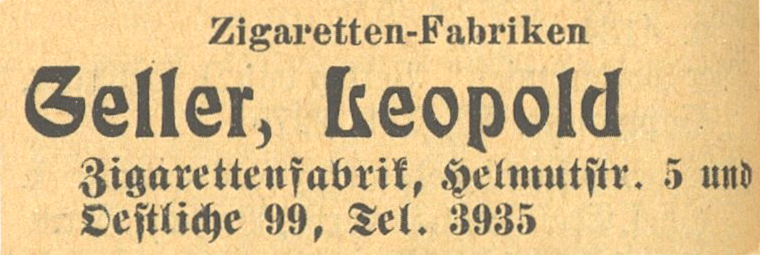
Autoren: Projektgruppe „Geschichte aktiv“
Katinka Wolff (geb. Maier) wird am 30. August 1899 in Schöllkrippen geboren.
Sie lebt mit ihrem Mann Walter und ihrem Sohn in der Jahnstraße 21.
Aufgrund der Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten flüchtet sie mit ihrer Familie 1937 nach Paris. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wird ihr Mann am 11. September 1939 nach Marolles in ein Internierungslager gebracht. Katinka und ihr Sohn flüchten nach dem Einmarsch der Deutschen aus Paris, kehren jedoch nach circa 7 Wochen wieder zurück. Walter Wolff wird am 31. Oktober 1940 aus dem Lager entlassen und zur Arbeitskompanie überwiesen. Schlussendlich entlässt man ihn am 19. Dezember 1940 auch dort nach Lyon. Nach der Entlassung ihres Mannes gelingt es ihr mit ihrem Sohn von Noisy-le-Sec zu ihm zurückzukehren.
Katinka und Walter sind bis 1943 als Hilfsarbeiter in einer Schmuckfabrik tätig. Die Verfolgung durch die Gestapo zwingt die beiden jedoch den Beruf aufzugeben. Ihnen gelingt es nach der Befreiung Lyons die Beschäftigung wieder aufzunehmen.
Ab 1957 lebt das Ehepaar Wolff wieder in Pforzheim.
Katinka Wolff stirbt am 17. Juni 1964 in Heidelberg.
Autoren: Projektgruppe „Geschichte aktiv“

Walter Wolff wird am 7. April 1896 in Militsch (Schlesien) geboren.
Er wohnt zuletzt mit seiner Frau Katinka und dem Sohn in der Jahnstraße 21. Der gelernte Kaufmann arbeitet als Bürstenfabrikant. Aufgrund des nationalsozialistischen Drucks löst sich sein Betrieb auf und er wird politisch verfolgt. Im Jahr 1937 gelingt ihm mit seiner Familie die Flucht nach Paris.
Es gelingt ihm vorerst nicht, eine produktive Beschäftigung auszuüben.
Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wird er am 11. September 1939 nach Marolles in ein Internierungslager gebracht. Seine Familie flüchtet nach dem Einmarsch der Deutschen aus Paris, kehrt jedoch nach circa 7 Wochen wieder zurück. Walter Wolff wird am 31. Oktober 1940 aus dem Lager entlassen und zur Arbeitskompanie überwiesen. Schlussendlich entlässt man ihn am 19. Dezember 1940 auch dort nach Lyon.
Katinka und sein Sohn schaffen es nach Lyon zu fliehen. Seine Frau und er selbst sind bis 1943 als Hilfsarbeiter in einer Schmuckfabrik tätig. Die Verfolgung der Gestapo zwingt die beiden jedoch den Beruf aufzugeben. Ihnen gelingt es nach der Befreiung Lyons die Beschäftigung wieder aufzunehmen.
Ab 1957 lebt das Ehepaar Wolff wieder in Pforzheim.
Walter Wolff verstirbt am 4. Oktober 1981 im Alter von 85 Jahren.
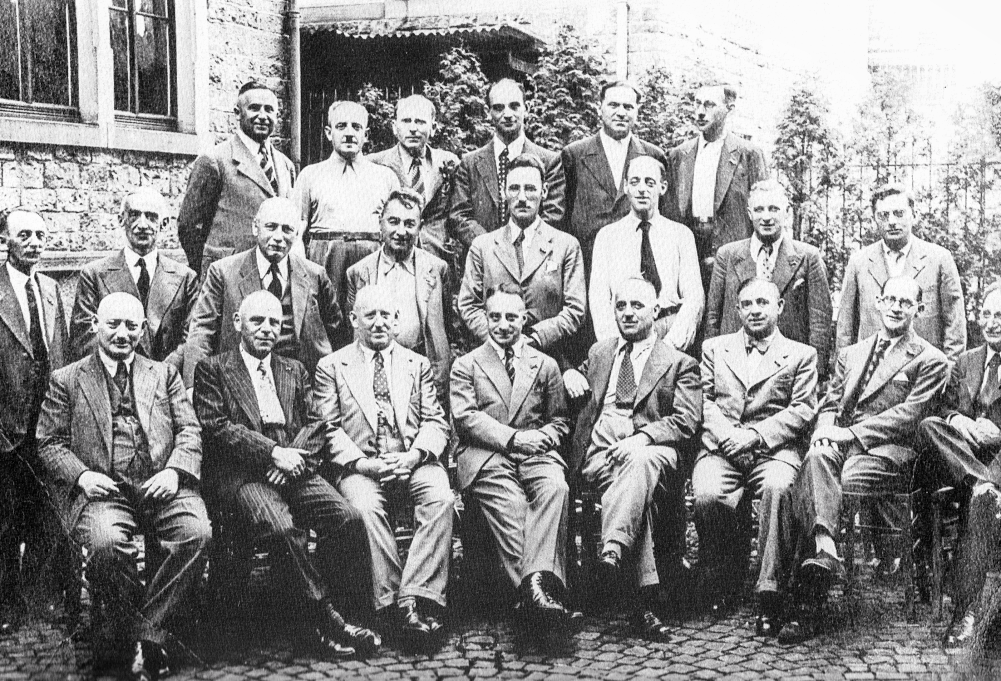
Autoren: Projektgruppe „Geschichte aktiv“